
Grübeln oder Sorgen – was treibt dein Overthinking an?
Warum verlieren wir uns im Grübeln – und andere in Sorgen?
Viele Menschen kennen das Gefühl, im Kopf gefangen zu sein – Gedanken, die sich im Kreis drehen, obwohl man längst weiß, dass sie zu nichts führen. Doch Overthinking ist nicht immer gleich Overthinking. Es zeigt sich in zwei Formen, die sich ähnlich anfühlen, aber unterschiedlich funktionieren: Grübeln und Sorgen.
Während das Grübeln uns immer wieder in die Vergangenheit zieht – zu Dingen, die wir vielleicht anders hätten machen sollen –, richtet sich das Sorgen auf die Zukunft. Wir denken an mögliche Fehler, Risiken oder unangenehme Situationen, die vielleicht noch kommen könnten. Beides folgt demselben Muster: Der Verstand sucht Kontrolle in Momenten, in denen sie gar nicht möglich ist.
Wenn du meine Hauptseite über Overthinking gelesen hast, erinnerst du dich vielleicht an diesen Satz: Denken verliert seine Richtung. Genau das passiert hier. Grübeln bleibt im Gestern stecken, Sorgen laufen dem Morgen hinterher – und beides raubt uns die Klarheit des Jetzt. In diesem Kapitel schauen wir uns an, was beide Formen voneinander unterscheidet, was sie im Gehirn auslöst und wie du sie erkennen kannst, bevor sie dich in ihren Bann ziehen.
Zwei Richtungen, ein Muster: Warum Grübeln nach hinten schaut – und Sorgen nach vorn.
Wenn wir über Overthinking sprechen, meinen wir oft beides – Grübeln und Sorgen. Doch obwohl sie ähnlich klingen, sind sie zwei unterschiedliche mentale Prozesse. Das Grübeln zieht dich in die Vergangenheit, während das Sorgen dich in die Zukunft drängt. Beide wirken auf dieselbe Weise: Dein Kopf versucht, ein Gefühl von Kontrolle zu erzeugen, das es so gar nicht geben kann.
Beim Grübeln drehen sich die Gedanken meist um Vergangenes: Was hättest du besser machen können? Warum hast du etwas gesagt oder nicht gesagt? Das Denken sucht nach einer Erklärung oder gar einer Rücknahme der Vergangenheit – etwas, das unmöglich ist. Die Energie bleibt gebunden, weil sie keinen Abschluss findet. Grübeln fühlt sich schwer, kreisend und selbstkritisch an.
Sorgen dagegen richten sich auf das, was vor dir liegt. Dein Kopf spielt unzählige „Was wäre wenn“-Szenarien durch. Du versuchst, dich auf jede Eventualität vorzubereiten, Fehler zu vermeiden oder unangenehme Situationen zu verhindern. Aber weil die Zukunft nie planbar ist, erzeugt das Sorgen keine Sicherheit, sondern ständige innere Unruhe.
Beide Formen haben denselben Ursprung: das Bedürfnis nach Sicherheit in einer unsicheren Welt. Doch während Grübeln den Blick nach hinten richtet und in Schuld oder Selbstkritik endet, schaut Sorgen nach vorne – getrieben von Angst und Kontrollbedürfnis. Das Ergebnis ist ähnlich: Du verlierst den Kontakt zur Gegenwart und bleibst in gedanklichen Schleifen gefangen.
Um den Unterschied greifbar zu machen, hilft ein kurzer Vergleich, den du dir merken kannst: Grübeln ist wie das Zurückspulen eines Films, den du nicht mehr ändern kannst. Sorgen sind wie das endlose Vorspulen eines Films, den du noch gar nicht gesehen hast.
| Aspekt | Grübeln (Rumination) | Sorgen (Worry) |
|---|---|---|
| Zeitliche Ausrichtung | Richtet sich auf die Vergangenheit – was war, was man hätte besser machen können. | Richtet sich auf die Zukunft – was passieren könnte oder schiefgehen könnte. |
| Typischer Gedankentyp | „Warum habe ich das gesagt?“ oder „Was, wenn ich es falsch gemacht habe?“ | „Was, wenn das schiefgeht?“ oder „Wie kann ich das verhindern?“ |
| Emotionale Begleiterscheinung | Schuld, Scham, Selbstkritik | Angst, Unsicherheit, Anspannung |
| Kognitiver Fokus | Analyse vergangener Fehler, Suche nach Kontrolle über etwas, das vorbei ist. | Vorwegnahme möglicher Risiken, Versuch, Kontrolle über Unbekanntes zu erlangen. |
| Typische Körperreaktionen | Schwere, gedrückte Stimmung, Müdigkeit | Innere Unruhe, flacher Atem, Muskelanspannung |
| Psychologisches Ziel | Verstehen und „ungeschehen machen“ wollen | Vorbereiten und vermeiden wollen |
| Ergebnis | Gefangen in der Vergangenheit, Verlust von Energie und Selbstwert | Gefangen in hypothetischen Szenarien, Verlust von Ruhe und Gelassenheit |
Warum dein Gehirn beim Grübeln und Sorgen nicht abschalten kann
Wenn du dich beim Denken im Kreis drehst, hat das nichts mit Schwäche oder fehlender Disziplin zu tun. In deinem Gehirn läuft ein klar erkennbarer Mechanismus ab, der ursprünglich zu deinem Schutz gedacht war. Im Zentrum steht dabei ein uraltes Alarmsystem – die Amygdala. Sie reagiert blitzschnell auf Unsicherheit und interpretiert selbst kleine Signale als potenzielle Gefahr. Das war in der Steinzeit überlebenswichtig, heute aber führt es dazu, dass dein Gehirn oft zu viel Alarm schlägt – auch dann, wenn keine reale Bedrohung da ist.
Während die Amygdala Alarm ruft, versucht der präfrontale Kortex – der Teil deines Gehirns, der für Logik und Planung zuständig ist – wieder Ordnung herzustellen. Doch das klappt nur bedingt. Wenn die Amygdala überaktiv ist, wird der präfrontale Kortex regelrecht blockiert. Du kannst dann nicht mehr klar entscheiden, weil dein Gehirn in eine Art „Analyse-Modus“ rutscht, in dem es ständig versucht, Kontrolle zurückzugewinnen. Genau hier beginnt das Overthinking.
Bei Grübeln und Sorgen zeigt sich dieser Mechanismus leicht unterschiedlich. Grübeln aktiviert besonders das sogenannte Default Mode Network – ein Netzwerk von Hirnregionen, das immer dann aktiv ist, wenn du nach innen schaust, über dich selbst nachdenkst oder vergangene Erlebnisse verarbeitest. Wenn du also grübelst, läuft dieses Netzwerk auf Hochtouren. Das Problem: Es findet keinen Abschluss, weil es immer wieder dieselben Erinnerungen aufruft, ohne sie emotional zu befrieden.
Sorgen hingegen aktivieren stärker die Amygdala und Bereiche, die mit Angst und Zukunftsplanung verknüpft sind. Dein Gehirn entwirft hypothetische Szenarien, um dich vorzubereiten – aber statt Sicherheit entsteht ein Dauerzustand von innerer Anspannung. Du spürst das oft körperlich: ein Druck im Brustkorb, verspannte Schultern, flacher Atem.
Beide Mechanismen – Grübeln wie Sorgen – haben also denselben Ursprung: ein überaktives Alarmsystem und ein überforderter Kontrollapparat. Erst wenn du lernst, diesen Kreislauf zu unterbrechen, kann dein Gehirn wieder in den Normalzustand zurückkehren. Achtsamkeit, Atemübungen oder kurze Körperwahrnehmungen helfen, die Amygdala zu beruhigen und den präfrontalen Kortex wieder zu aktivieren. Dann wird das Denken klarer, und du kannst Entscheidungen treffen, ohne dich darin zu verlieren.
Wenn Denken zur Dauerschleife wird – wie Grübeln und Sorgen sich gegenseitig antreiben
Auf den ersten Blick scheinen Grübeln und Sorgen zwei verschiedene Dinge zu sein. Das eine hängt an der Vergangenheit, das andere fürchtet die Zukunft. Doch im Inneren arbeiten sie Hand in Hand. Beide entspringen demselben Impuls: dem Wunsch, Kontrolle zu gewinnen, wo Unsicherheit herrscht. Das Gehirn versucht, Ordnung herzustellen – und erzeugt dabei genau das Gegenteil.
Wenn du grübelst, durchforstest du alte Erinnerungen auf der Suche nach einem Grund, warum etwas schiefgelaufen ist. Du hoffst auf ein Gefühl der Erleichterung oder auf eine Art Abschluss. Doch genau das bleibt aus. Statt Klarheit entsteht emotionale Unruhe – und die weckt neue Gedanken: „Wie kann ich verhindern, dass mir das wieder passiert?“ So verwandelt sich Grübeln in Sorgen.
Das funktioniert auch andersherum. Wenn du dich sorgst, malst du mögliche Risiken aus. Du versuchst, dich auf alles vorzubereiten – und analysierst gleichzeitig vergangene Situationen, um Fehler zu vermeiden. Sorgen befeuern das Grübeln, Grübeln befeuert die Sorgen. Beide Mechanismen verstärken sich gegenseitig und nähren denselben inneren Stresszustand.
Psychologisch betrachtet ist das ein selbstverstärkender Kreislauf aus Gedanken und Emotionen. Ein unangenehmes Gefühl löst Gedanken aus, die das Gefühl wiederum verstärken. Dein Gehirn lernt, dass diese Schleife „normal“ ist, weil sie oft durchlaufen wird. So werden Grübeln und Sorgen zu automatischen Mustern – vertraut, aber zermürbend.
Der Schlüssel liegt darin, diesen Kreislauf zu erkennen, bevor er sich aufschaukelt. Sobald du bemerkst, dass dein Denken zwischen Vergangenheit und Zukunft pendelt, kannst du innehalten. Nicht, um die Gedanken zu stoppen, sondern um sie wahrzunehmen. In dem Moment, in dem du erkennst, „Ah, jetzt bin ich wieder im Loop“, beginnt sich die Schleife zu lösen.
Was die Forschung sagt – drei Schlüsselmodelle, die Grübeln und Sorgen erklären
In der psychologischen Forschung sind Grübeln und Sorgen seit Jahrzehnten intensiv untersucht worden. Drei Modelle haben besonders dazu beigetragen, zu verstehen, warum wir in diesen Denkschleifen hängenbleiben und wie sie sich unterscheiden.
Das erste stammt von Susan Nolen-Hoeksema, die den Begriff der Rumination maßgeblich geprägt hat. Ihr Modell beschreibt Grübeln als eine Form von passivem, wiederholtem Denken über negative Emotionen und deren Ursachen. Anstatt zu einer Lösung zu führen, verlängert Grübeln den negativen Zustand, weil sich das Denken ausschließlich um das Problem selbst dreht – nicht um einen möglichen Ausweg. Nolen-Hoeksema zeigte in zahlreichen Studien, dass Rumination eng mit Depressionen und Selbstzweifeln verbunden ist, weil sie die Fähigkeit blockiert, Emotionen flexibel zu regulieren.
Das zweite Modell, das sogenannte Cognitive Avoidance Model of Worry von Thomas Borkovec, beschreibt Sorgen als eine Art „mentales Vermeidungsverhalten“. Nach diesem Ansatz erzeugen Menschen mit hoher Sorgenneigung Gedankenketten, um unangenehme Emotionen auf Abstand zu halten. Das Denken dient hier als Ablenkung von körperlich spürbaren Gefühlen wie Angst oder Unsicherheit. Kurzfristig wirkt diese Strategie beruhigend, langfristig verstärkt sie aber die innere Anspannung, weil die zugrunde liegenden Emotionen nie wirklich verarbeitet werden.
Das dritte, das Metacognitive Model von Adrian Wells, verbindet beide Mechanismen zu einer gemeinsamen Erklärung. Wells geht davon aus, dass sowohl Grübeln als auch Sorgen auf fehlerhaften „Meta-Glaubenssätzen“ beruhen – also Überzeugungen darüber, wie Denken funktioniert. Viele Menschen glauben, dass Nachdenken grundsätzlich hilft, Probleme zu lösen. Wenn sie dann zu viel denken, interpretieren sie das als Zeichen von Verantwortungsbewusstsein oder Kontrolle. Tatsächlich aber wird das Denken dadurch zum Problem selbst. Wells zeigte, dass die entscheidende Veränderung nicht darin liegt, weniger zu denken, sondern das Denken anders zu bewerten – als mentalen Prozess, nicht als Realität.
Gemeinsam zeigen diese Modelle: Grübeln und Sorgen sind keine getrennten Phänomene, sondern zwei Varianten desselben mentalen Musters – dem Versuch, durch Denken Kontrolle über Emotionen zu gewinnen. Die Forschung bestätigt, dass dieser Versuch scheitern muss, weil Denken Gefühle nicht ersetzt. Erst wenn wir lernen, Gedanken zu beobachten, ohne sie zu glauben, verliert das Overthinking seine Macht.
Wie du aus der Grübel- und Sorgen-Schleife aussteigst
Zu verstehen, wie Overthinking funktioniert, ist der erste Schritt – doch wirklich entscheidend ist, wie du aus dieser gedanklichen Dauerschleife wieder herauskommst. Grübeln und Sorgen verlieren ihre Macht nicht durch noch mehr Nachdenken, sondern durch bewusste Unterbrechung und eine neue Haltung dem Denken gegenüber.
Ein wirksamer Ansatz ist die Achtsamkeitspraxis. Sie hilft dir, deine Aufmerksamkeit vom Kopf in den Moment zu bringen. Wenn du bemerkst, dass deine Gedanken wieder Kreise ziehen, kannst du innehalten und dich auf etwas Konkretes konzentrieren: deinen Atem, deine Füße auf dem Boden oder die Geräusche um dich herum. So schaltest du vom Modus des Grübelns in den Modus des Wahrnehmens. Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeit die Aktivität im sogenannten Default Mode Network senkt – also in genau jenem Netzwerk, das für Grübeln verantwortlich ist.
Ein zweiter Weg ist die metakognitive Perspektive, also der bewusste Blick auf dein Denken selbst. Du kannst dir angewöhnen, Gedanken nicht mehr automatisch für wahr zu halten. Statt „Ich muss das lösen“ sagst du dir: „Ich habe gerade den Gedanken, dass ich das lösen muss.“ Dieser kleine sprachliche Abstand verändert die Beziehung zu deinem Denken. Du wirst vom Teilnehmer zum Beobachter – und das allein schafft Erleichterung.
Auch kognitive Umstrukturierung kann helfen, die innere Logik des Overthinkings zu durchbrechen. Dabei stellst du belastende Denkmuster bewusst infrage: Ist das wirklich so? Gibt es auch eine andere Sichtweise? Solche kleinen Perspektivwechsel öffnen mentale Räume, in denen sich die Spirale verlangsamt.
Und schließlich spielen körperliche Routinen eine wichtige Rolle. Bewegung, Atemarbeit oder kurze Pausen signalisieren deinem Nervensystem, dass keine Gefahr besteht. Dadurch sinkt der innere Alarmpegel, und dein Gehirn kann wieder klarer arbeiten.
Die gute Nachricht: Du musst das Denken nicht bekämpfen. Es reicht, wenn du lernst, es anders zu behandeln. Wenn du deinen Gedanken nicht mehr automatisch folgst, sondern sie kommen und gehen lässt, verliert das Overthinking seinen Halt. Dann entsteht zwischen dir und deinen Gedanken ein Raum – und genau dort beginnt Ruhe.
Fazit – Denken als Werkzeug, nicht als Gefängnis
Grübeln und Sorgen sind keine Zeichen von Schwäche, sondern der Versuch deines Gehirns, dich zu schützen. Doch dieser Schutzmechanismus läuft ins Leere, wenn du versuchst, durch Denken Sicherheit zu erzeugen, wo keine Gewissheit möglich ist. Übermäßiges Nachdenken ist letztlich ein Ausdruck von Fürsorge – aber eine, die sich gegen dich richtet.
Wenn du beginnst, dein Denken als Werkzeug zu begreifen, ändert sich alles. Gedanken kommen und gehen, so wie Wellen auf dem Meer. Du musst sie nicht festhalten, du musst sie auch nicht bekämpfen. Du kannst sie wahrnehmen und entscheiden, welche davon du wirklich ernst nehmen willst.
Je öfter du das übst, desto mehr Distanz entsteht zwischen dir und deinen Gedanken. In dieser Distanz liegt Freiheit – die Freiheit, nicht jedem inneren Impuls zu folgen. Mit der Zeit wirst du merken: Dein Geist kann ruhig sein, ohne leer zu sein. Klar, ohne kontrollierend zu werden. Und genau dort, in dieser neuen Beziehung zu deinem Denken, endet das Overthinking.
Overthinking: Wenn Denken zur Falle wird
Weitere Artikel zu Overthinking
📘 Overthinking: Wenn Denken zur Falle wird
Was passiert im Kopf, wenn Grübeln zur Gewohnheit wird? Die neurobiologischen und psychologischen Grundlagen des Overthinkings – klar und verständlich erklärt.
→ Zum Hauptartikel🚪 Wenn Denken dich isoliert: Warum Overthinking in den Rückzug führt
Wie Overthinking zu sozialer Vermeidung führt – und warum der Versuch, sich zu schützen, oft zu innerer Einsamkeit führt.
→ Zum Artikel💬 Overthinking in der Kommunikation: Wenn Denken deine Sprache zähmt
Warum übermäßiges Nachdenken Gespräche verlangsamt, Selbstbewusstsein schwächt und Klarheit in Sprache und Beziehung kostet.
→ Zum Artikel🧩 Warum manche Menschen zu Overthinking neigen
Persönlichkeit, Emotion und Biologie – warum manche Gehirne sensibler auf Unsicherheit reagieren und stärker zum Grübeln neigen.
→ Zum Artikel📅 Wie sich Overthinking im Alltag zeigt
Sprache, Entscheidungen, Überplanung, Kontrolle – die häufigsten Verhaltensmuster und wie sie sich unmerklich im Alltag verankern.
→ Zum ArtikelDein kostenloser Kurs
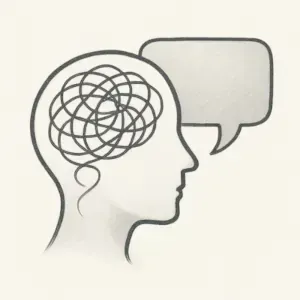
Sag, was du meinst – Kommunikation ohne Overthinking
Wenn du merkst, dass du beim Sprechen ständig nach den richtigen Worten suchst oder Sätze abbrichst, hilft dir dieser kurze Mikrokurs weiter.
In wenigen Minuten erkennst du typische Overthinking-Muster in deiner Sprache und bekommst ein Gefühl dafür, wie du wieder klarer und entspannter kommunizierst.
Dein Experte
Oliver Berndorf
Lead Business Analyst, Projektmanager und Dozent
Ich kenne Overthinking nicht aus Büchern, sondern aus eigener Erfahrung. Als jahrelanger Overthinker habe ich gelernt, wie lähmend ständiges Grübeln sein kann – und wie befreiend es ist, den Kopf wieder klar zu bekommen. Heute gebe ich dieses Wissen weiter, kombiniert mit meiner Erfahrung aus über 20 Jahren Projektmanagement und Business Analyse.
Vertiefe dein Wissen
Wenn du Overthinking besser verstehen und endlich stoppen möchtest, schau dir meinen Kurs auf Udemy an.
Dort lernst du Schritt für Schritt, wie du deinen Kopf beruhigst, klarer denkst und wieder mit mehr Leichtigkeit handelst.